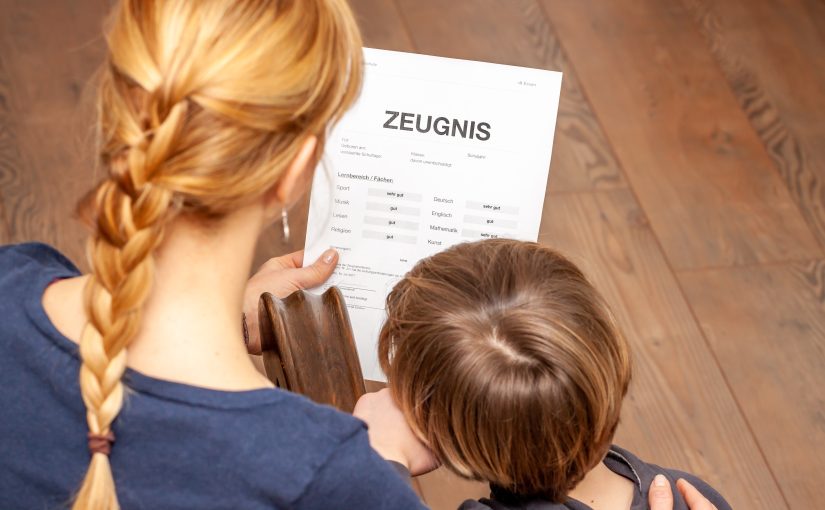Es existieren verschiedene Ausgangslagen, die eine Schulleitung oder die Schulpflege veranlassen können, ein:e Schüler:in in eine parallel geführte Klasse zuzuweisen. Begrifflich handelt es sich um eine sogenannte Querversetzung. Hierbei kann es zu konfligierenden Interessen zwischen den Erziehungsberechtigten und der Schulleitung beziehungsweise der Schulpflege kommen. Was die rechtlichen Bedingungen sind und was dazu führen kann, ein Kind querzuversetzen, erläutert Thomas Bucher.
Die nachfolgenden Ausführungen referenzieren auf ein Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich vom 18. März 2021 (VB.2021.00109) und sind für Schulleitungen und Schulpflegen nicht nur im Falle von Querversetzungen bedeutsam.
Art. 62 Abs. 1 der Schweizerischen Bundesverfassung vom 18. April 1999 (BV, SR 101) nennt die Kantone als für das Schulwesen zuständig. Sie haben für einen ausreichenden, an öffentlichen Schulen unentgeltlichen, Grundschulunterricht zu sorgen, der obligatorisch ist und allen Kindern offensteht (Art. 19 in Verbindung mit Art. 62 Abs. 2 BV).
Der erwähnte Anspruch auf ausreichenden und unentgeltlichen Schulunterricht erstreckt sich nicht auf die freie Schul- oder Klassenwahl. § 62 Abs. 2 der Volksschulverordnung des Kantons Zürich vom 28. Juni 2006 (VSV, LS 412.101) verwehrt die Elternmitwirkung explizit bei «Anordnungen organisatorischer Art wie der Zuteilung zu einer Schule oder einer Klasse sowie bei Weisungen im Schulalltag oder bei der Notengebung und der Schülerbeurteilung».
Voraussetzungen für das rechtmässige Querversetzen in der Volksschule des Kantons Zürich weiterlesen