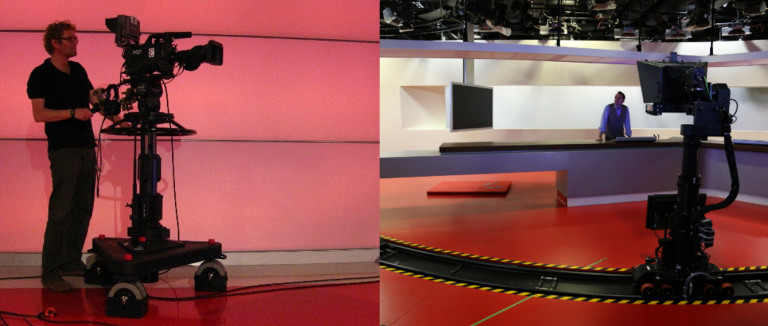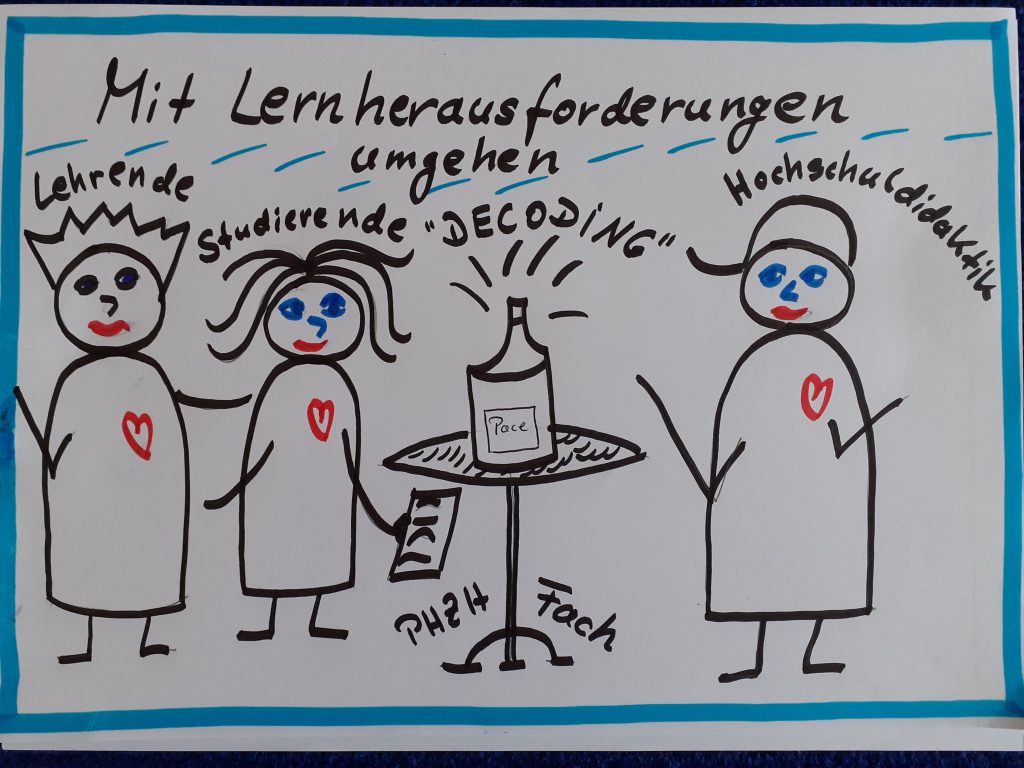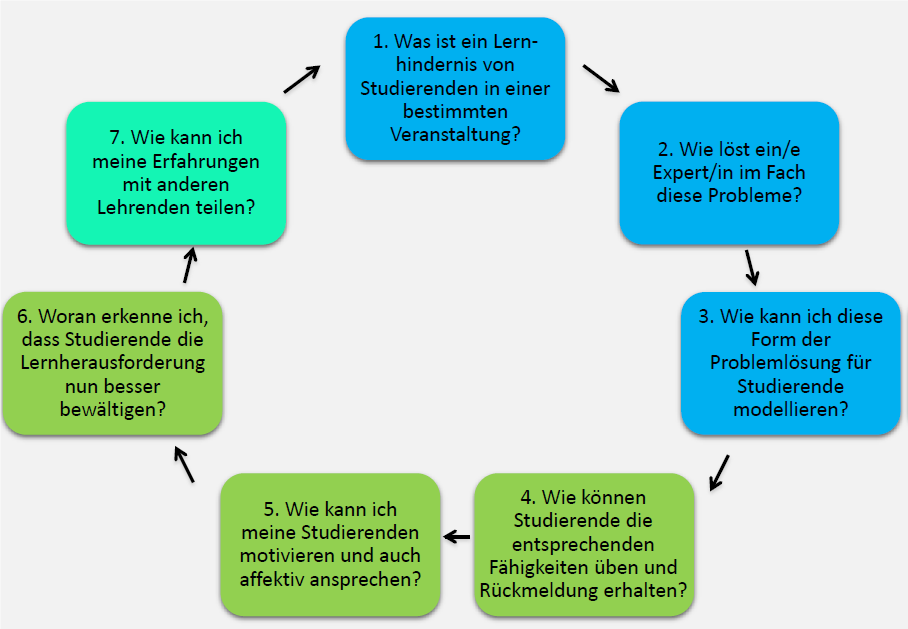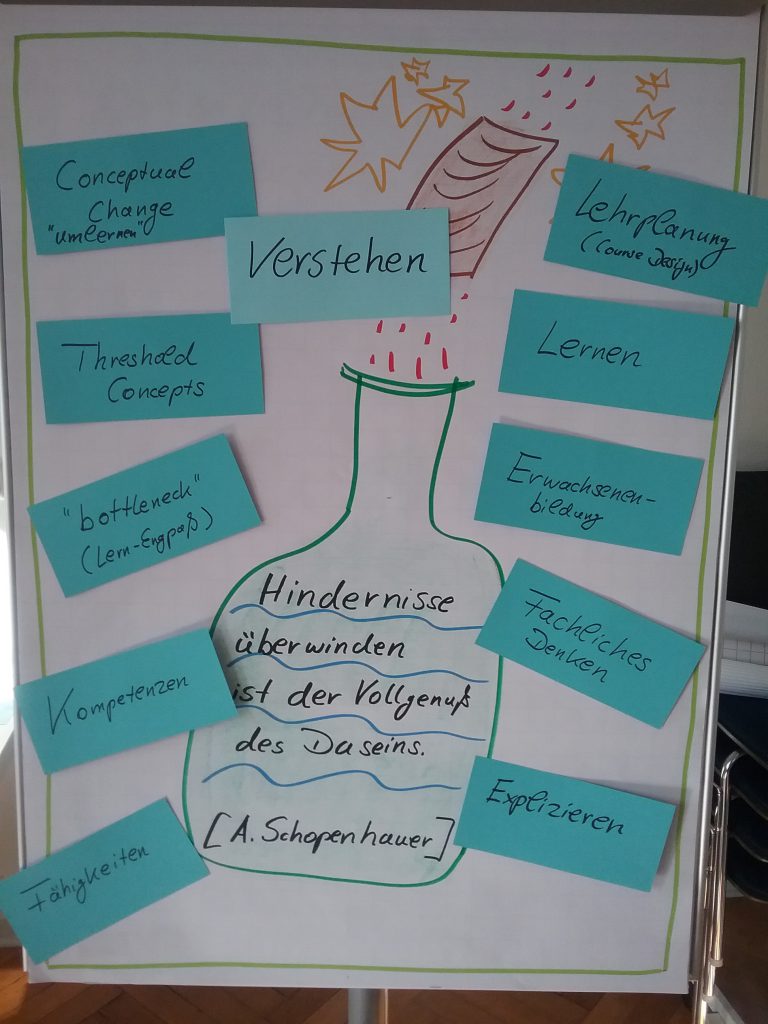Beitrag von Simone Heller-Andrist und Christa Scherrer
Wie kann ich als PH-Mitarbeitende in meiner täglichen Arbeit Bezüge zum Berufsfeld herstellen, welches mit der Aufgabe, die ich gerade bearbeite, korrespondiert? Und auf welche anderen Bezüge greife ich zusätzlich zurück? Ein Beispiel zur Illustration: Als Anglistin, die als Fachdidaktikerin tätig ist, wähle ich für meine Lehre auf Tertiärstufe aus einer grossen Fülle von Themen aus meinem Fachbereich aus. Meine Auswahl schneide ich auf mein Publikum, dessen Vorwissen, Lernfortschritt und den Fokus des jeweiligen Moduls zu. Für die Lehre orientiere ich mich an institutionellen Rahmenvorgaben wie Curriculum und Lehrplänen, bin im Austausch mit meinen Fachkolleg:innen, bediene ich mich hochschuldidaktischer Methoden in der Vermittlung und arbeite ich Beispiele aus der Schul- oder Forschungspraxis auf. Mein Netz an Bezügen ist dabei beträchtlich, und mit der Dynamik der Gesellschaft, der Schule, meiner Institution, meiner Fachwissenschaft, und nicht zuletzt von mir selbst entwickle ich dieses Netz laufend weiter. Neue Erkenntnisse aus der Schulpraxis lassen mich eine neue Wahl von Themen im Fachbereich treffen. Ich bilde mich weiter, experimentiere, entwickle ein neues Lehrverständnis, passe meine eigenen Philosophien an. Und vieles davon geschieht implizit, ohne dass ich es selbst aktiv sichtbar mache.
Bezüge sichtbar machen
Es war eine Aufgabe des Projekts Doppeltes Kompetenzprofil an Pädagogischen Hochschulen aus dem Nachwuchsförderprogramm P11 von swissuniversities, die Vielfalt an Kompetenzen ausgehend vom sogenannten doppelten Kompetenzprofil zu fassen. Letzteres orientiert sich gleichzeitig an der Berufspraxis und der Wissenschaftspraxis und entwickelt so das Verständnis für die Anforderungen an das wissenschaftliche Personal an Pädagogischen Hochschulen (PH) und seine Profile weiter. Die aktuelle Ausgabe der Beiträge zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung ist eigens dem doppelten Kompetenzprofil gewidmet. In ihrem Beitrag zum Thema stellen Scherrer et al. den Bezug zum Schulfeld im Rahmen eines Kompetenzprofils des wissenschaftlichen Personals an PHs dar. Sie schaffen damit eine Grundlage, um die Kompetenzen der Mitarbeitenden individualisiert und aufgabenbezogen fassbar zu machen. So liesse sich beispielsweise die eingangs am Beispiel der Anglistin beschriebene Kompetenzvielfalt, aus der ihre Performanz gespiesen wird, aufgeteilt auf Kompetenzbereiche erfassen. Und so wird die Vielfalt an Kompetenzen sichtbar, aus der PH-Mitarbeitende in ihrer täglichen Arbeit schöpfen.
Kompetenzbereiche in gegenseitiger Abstimmung
Die drei Bereiche der berufsfeldbezogenen, der disziplinären und der institutionell-organisationalen Kompetenzen bestimmen sich gegenseitig mit (vgl. Abb. 1). Der Beitrag «Die Bedeutung des Berufsfeldbezugs in den Aufgaben und für die Laufbahn an Pädagogischen Hochschulen», der von Erika Stäubles Modell der «Fachlichkeit in drei Ausprägungen» ausgeht, macht dies deutlich. Zur Illustration zwei Beispiele: Gestaltet die Anglistin ein neues Modul, wird sie die Themensetzungen nicht nur ausgehend vom Modulschwerpunkt im Gesamtzusammenhang der Ausbildungsstruktur (organisationale Kompetenz), sondern auch ausgehend von berufsfeldbezogenen Erkenntnissen (berufsfeldbezogene Kompetenzen) vornehmen. Ein Dozent in Liedbegleitung, der den Pilotstudiengang «Den Berufsfeldbezug stärken!» besucht hatte, berichtete von seiner Erkenntnis, dass er seinen Studierenden künftig zur Komplexitätsreduktion in ihren Unterrichtsvorhaben rät. Nebst der Liedbegleitung benötigen sie insbesondere auch Kapazitäten für die Klassenführung.

Kompetenzprofil des wissenschaftlichen Personals (Scherrer, Heller-Andrist, Suter & Fischer, 2020)
Bestandesaufnahme starker Berufsfeldbezüge
Die Vielfalt der berufsfeldbezogenen Kompetenzen zeigt sich exemplarisch in der Publikation Mittendrin ist vielerorts. Wissenschaftsjournalist Urs Hafner zeigt in 22 Porträts von Dozierenden aus 13 PHs, mit welchen Methoden und in welchen Konstellationen ihr Berufsfeldbezug in Lehre, Unterricht, Führung, Entwicklung, Organisation und weiteren Tätigkeiten zum Tragen kommt und wie er sich ins Gesamtprofil der Porträtierten einpasst. So wird etwa deutlich, dass das Wissen um die Arbeit der Lehrpersonen mit Lehrmitteln für die Entwicklung letzterer an der PH essenziell ist. Einige der Porträtierten haben den Studiengang «Den Berufsfeldbezug stärken!» absolviert, um vertiefte Innensichten des Schulfelds zu gewinnen. Eine Dozentin nutzte ihre dort gewonnenen Erkenntnisse, um das Weiterbildungsangebot für Lehrpersonen an Berufsfachschulen nach den aktuellen Bedürfnissen in Schulfeld und PH auszurichten. Eine Führungsperson befasst sich eingehend mit den Anforderungen des Berufsfelds, um die Möglichkeiten für Laufbahnen an PHs zeitgemäss zu gestalten, zu erweitern und neue Qualifikationsmöglichkeiten zu etablieren.

Podiumsdiskussion an der Vernissage von Mittendrin ist vielerorts vom 25. März 2021: v.l.: Tabea Steiner («L’oeil extérieur»), Heinz Rhyn (Vorwort) und Herausgeber und Autor Jürg Arpagaus.
CAS-Studiengang zur Stärkung des Berufsfeldbezugs
Im CAS-Studiengang «Den Berufsfeldbezug stärken!» laufen die Fäden des Kompetenzreichtums von PH-Mitarbeitenden zusammen: Er ermöglicht es dem wissenschaftlichen Personal an PHs, ihren Berufsfeldbezug aufgabenspezifisch aufzubauen, zu erweitern oder zu aktualisieren. Der Studiengang wird in Kooperation von neun PHs (PH Zug, PH Zürich, PH Luzern, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, PH Fachhochschule Nordwestschweiz, PH Schwyz, PH St. Gallen, PH Thurgau, PH Graubünden) angeboten. Eine Begleitgruppe zum Studiengang mit Mandatierten aller beteiligten Hochschulen setzt sich zum Ziel, den Diskurs zur Laufbahnrelevanz des Angebots weiterzuführen und an der eigenen Institution zu vertreten. Die PH Zürich hat das Zertifikat des Studiengangs bereits als äquivalenten Nachweis über den Schulfeldbezug seines wissenschaftlichen Personals gemäss Hochschulordnung der PHZH (§24.2) anerkannt.
INFOBOX
Der CAS «Den Berufsfeldbezug stärken!» startet im September 2021, alle Informationen dazu finden Sie auf unserer Webseite. Im kurzen Informationsfilm erhalten Sie erste Einblicke in den Studiengang. Oder melden Sie sich zur Online-Informationsveranstaltung am 8. Juni 2021, 17–18 Uhr, an, um alle Details rund um den CAS zu erfahren und Ihre Fragen an die Studiengangsleitung zu richten.
Weitere Informationen zur Publikation Mittendrin ist vielerorts finden sich auf der Website des hep-Verlags.

Zu den Autorinnen
Simone Heller-Andrist und Christa Scherrer waren 2019/3 bis 2021/4 zusammen Co-Projektleiterinnen des Projekts «Doppeltes Kompetenzprofil der PH – institutionelle und individuelle Anforderungen an den Berufsfeldbezug» und sie sind zusammen mit Jürg Arpagaus und Susanne Amft Mitherausgeberinnen des Buchs «Mittendrin ist vielerorts».

Simone Heller-Andrist arbeitet am ZHE Zentrum für Hochschuldidaktik und -entwicklung der PH Zürich als Projektleiterin für Entwicklungs- und Weiterbildungsangebote im Hochschulbereich. Sie leitet den CAS Hochschuldidaktik «Winterstart» und den im Herbst 2021 startenden CAS «Den Berufsfeldbezug stärken!».

Christa Scherrer ist Erziehungswissenschaftlerin und Primarlehrerin mit besonderem Interesse bezüglich dem Verhältnis zwischen Menschen, Organisationen und deren Entwicklungen. Sie ist Dozentin und Mentorin an der PH Zug, Evaluatorin des ifes.

 Yves Furer ist Dozent für Deutschdidaktik und Mitarbeiter des
Yves Furer ist Dozent für Deutschdidaktik und Mitarbeiter des