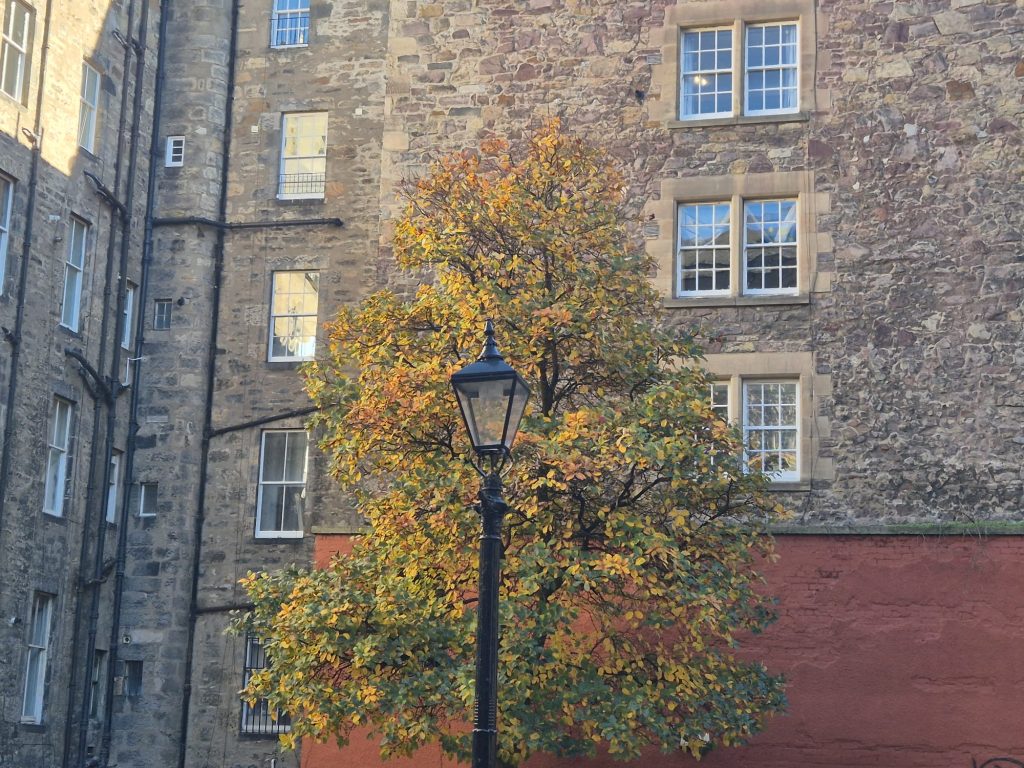Der Songtext «Das Leben ist» von HE/RO wird als Ausgangspunkt für eine poetische Reflexion über eigene Erfahrungen und Assoziationen genommen:
HE/RO Das Leben ist https://matchlyric.com/he-ro-das-leben-ist
Das Leben ist, drei Jahre lang betrogen werden
Und wenn du’s rausgefunden hast, trotzdem belogen werden
Das Leben ist, wenn alte Freunde fast an Drogen sterben
Das Leben ist, wenn Manager mit deiner Kohle werfen
Das Leben ist die Kündigung am zweiten Tag
Es ist, so viel auf dеm Herz zu haben, aber kеiner fragt
Das Leben ist, wenn Sechste-Klasse-Trauma kickt
Das Leben ist, wenn Mobbing in der Schule dein Vertrauen fickt
Das Leben ist Angst haben vorm Angst haben
Schweißgebadet aufwachen, fünf Uhr früh an Samstagen
Und immer, wenn ich denk‘: „Ich halt‘ es kaum mehr aus“
Sagt ein leiser Teil: „Mach die Augen auf“
Refrain:
Das Leben ist schön
Du kannst es nur nicht seh’n
Ich fühl‘ alle deine Trän’n und
Wie einsam man sein kann
Remake:
Das Leben ist
Das Leben ist, …………………………………………
Das Leben ist, …………………………………………
Das Leben ist, …………………………………………
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
Das Leben ist, …………………………………………
Das Leben ist, …………………………………………
Das Leben ist, …………………………………………
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
Das Leben ist, …………………………………………
Das Leben ist, …………………………………………
Das Leben ist, …………………………………………
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
Ein Remake von „nicolerendschmidt“, geposted auf TikTok:
„Das Leben ist eine psychische Störung zu haben,
und dir das erstmal einzugestehen und dann damit zu leben.
Das Leben ist, geliebte Menschen zu verlieren,
ohne sich zu verabschieden zu können.
Das Leben ist, sich selbst als nie genug zu empfinden.
Das Leben ist, immer der Zeit hinterher zurennen
und doch sie nie einfangen zu können.
ABER…..
Das Leben ist auch, deine Kinder aufwachsen zu sehen,
dir deine Träume zu erfüllen,
zu erkennen das deine Ängste besiegbar sind,
das du viel mehr schaffst als jemals erwartet.
Ja Leben ist schön.
Mit den guten und schlechten Seiten,
mit schönen und traurigen Tagen.
Denn das ist das Leben“